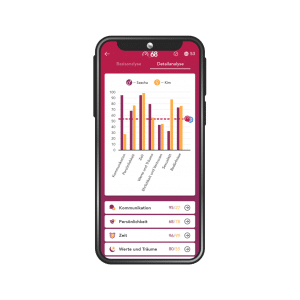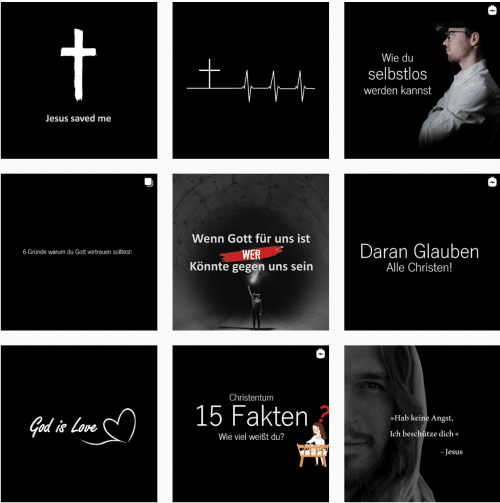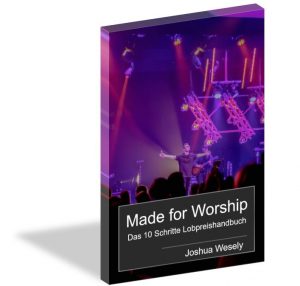Eine christliche Kurzgeschichte von Linde Eller
Bewegungslos kauere ich auf dem Boden wie ein zu Tode verwundetes Tier. Meine Glieder sind steif vor Kälte. Meine Augen brennen von den zahllosen Tränen, die ich vergossen habe, auch wenn sie jetzt trocken sind – leergeweint. Meine Haare hängen mir ins Gesicht in wirren, verklebten Strähnen. Ich starre auf meine blutverschmierten Hände. Auf meinen Wangen, meinem Mund spüre ich das getrocknete Blut. Sein salziger Geschmack liegt auf meinen Lippen. Ich weiß nicht, was davon von mir stammt – als ich mir die Lippen aufgebissen habe, das Gesicht zerkratzt vor Schmerz und Ohnmacht über sein Schicksal – , und was davon von ihm kommt, als ich seine blutigen Füße geküsst habe, voll abgrundtiefer Verzweiflung umklammert, so als könnte ich dadurch sein entwichenes Leben in den geschundenen, leergebluteten Körper zurückholen.
Ich stöhne auf, so laut, dass es unheimlich von den Felsen widerhallt, jäh die nächtliche Stille zerreißt. Ein unmenschlicher Ton, wie der Ruf eines einsamen Totenvogels, wie das Heulen eines verhungernden Wolfes, wie der Angstschrei eines tödlich verletzten Rehs. Über mir wabern dräuende schwarze Wolken vor dem bleichen Sichelmond. Dichte, verworrene Bäume werfen gespenstische Schatten auf die steinernen Höhlenöffnungen. Die schweren Düfte nachtblühender Pflanzen durchziehen den Garten, verspotten mich mit ihrer Süße, so als gäbe es noch Schönheit. Sie bedrängen meine Sinne, vermischen sich mit dem Geruch des Blutes in meiner Nase und drohen mich in weiteren, endlosen, ungeweinten Tränen zu ersticken. Er hat die Gärten immer so geliebt. Und nun ist alles zu Ende.
Ich bin alleine hier. Die anderen sind alle gegangen. Ich bleibe die ganze Nacht hier. Für immer. Mein Leben liegt tot hinter diesen Mauern – wohin sollte ich gehen?
Ich wollte ihn nicht loslassen, sie mussten mich von ihm wegzerren, viele zusammen, meine Arme, meine Finger, mein Gesicht, meine Lippen einzeln mit Gewalt von ihm lösen. Es kann sein, dass ich nach ihnen geschlagen habe. Und getreten. Das tut mir jetzt Leid.
Dann hat nur noch Joanna mich festgehalten, und wir haben zusammen geweint. Und dann ist auch Joanna gegangen.
Noch nie habe ich mich so verlassen, so verloren, so beraubt gefühlt, noch nicht einmal damals, bevor er kam. Erst wer die Sonne auf seiner Haut gespürt hat, weiß wie kalt die Finsternis ist.
Verse eines Liedes fallen mir ein, Verse des Liedes, das ich erst mit dreißig Jahren hätte hören dürfen – und auch nur hören, nicht lesen – , aus dem Mund des Ehemannes, den ich nie hatte – und das ich doch mit fünfzehn Jahren schon heimlich las und als größten Schatz in meinem Gedächtnis verwahrte.
‚Auf meinem Lager in den Nächten suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht.‘
Bruchstücke eines Textes, den ich so oft vor mich hinsagte und dessen Wahrheit ich doch in keiner Stadt, in keinen Armen, bei keinem Menschen fand – bis er kam – und ein Wort aus seinem Mund tötete den Tod in meiner Seele; bis er kam – und ein Blick aus seinen Augen pflanzte die Lilie in meinen Garten.
‚Ich suchte ihn, aber ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, aber er antwortete mir nicht. Es fanden mich die Wächter, welche die Runde machen in der Stadt; sie schlugen mich wund, sie nahmen mir meinen Schleier weg‘ – den Schleier, den er mir wiedergegeben hatte. Er, der nun weg ist. Sie nahmen mir ihn weg – lieber sollten sie mich schlagen.
Außerhalb meiner Reichweite haben sie ihn gebracht, hinter diesen schweren Steinen, hinter Felswänden liegt er begraben. Nie wieder werde ich ihn berühren. Und selbst wenn – es wird nicht mehr er sein. ‚Seine Lippen wie Lilien, aus denen feinste Myrrhe fließt‘ – nun sind sie kalt und wächsern, nie wieder werde ich sie auf meiner Haut spüren. Mit heiserer Stimme schreie ich seinen Tod in die Nacht hinaus.
Als sie seinen Leichnam vor unsere Füße auf den Boden legten, dachte ich, die ganze Welt sei mit ihm gestorben. Als ich seinen zermarterten Körper sah, die klaffenden Wunden, meinte ich, ich müsste selbst sterben. Auch mein Bruder wurde gewaltsam getötet, aber er starb mit dem Schwert in der Hand, mit der Rüstung auf dem Körper. Auch mein Bruder hat als Rebell sein Leben verloren – die Römer wissen, dass wir einer der aufständischsten Stämme sind –, aber er starb ehrenvoll im Kampf, Mann gegen Mann. Er wurde nicht öffentlich verhöhnt, qualvoll gefoltert, schändlich ermordet. Ich wimmere leise.
Ein starker Wind ist aufgekommen und bläst durch mein dünnes Gewand, doch es kümmert mich nicht. Er zerfetzt die dichten, grauschwarzen Wolken am Himmel, fegt sie allmählich beiseite. Nach dem Unwetter zeigen sich nun vereinzelt die ersten Sterne. Er hat es immer geliebt, still die Sterne zu betrachten. Und ich mit ihm. Sie sind so klar, so rein, unverdorben, unnahbar. Alte griechische Sagen ziehen mir durch den Kopf, Fragmente wie die Wolkenfetzen über mir, von Menschen, Tieren, Wesen, die starben und an den Himmel versetzt wurden, die nun als prachtvolle Sternbilder die Menschheit auf ewig erhellen.
Für einen Moment scheint es, als würden mir die fernen Gestirne einen kleinen Trost zublinzeln. Aber nur für einen flüchtigen Moment. Es sind nur Sagen, Mythen, Lügen, die sogar römische Kaiser für sich beanspruchen. Kein Mensch wird in einen Stern verwandelt. Ihre Körper verwesen, zerfallen. Ihre Seelen – ich weiß es nicht.
Die Sterne – sie funkeln, als gäbe es noch Hoffnung, als gäbe es noch Leben, als gäbe es noch etwas Gutes in der Welt. Aber sie sind nicht von dieser Welt. Hier ist alles verdorben, rettungslos verloren. All meine Stärke ist geschmolzen, herabgeflossen und versickert wie der Schnee von den Bergen. Ich bin schutzlos, verletzlich, verwaist, wie ein Säugling in der Wüste, wie Asche im Wind, wie ein Mensch ohne Haut. Mein einziger Stern ist erloschen.
Am östlichen Horizont zeigt sich allmählich ein roter Streifen. Blutrot. Glutrot.
Hellrot wie die gezackten Striemen auf seinem Rücken. Tiefrot wie die Lachen in den Ritzen der Steinquader unter unzähligen achtlosen Füßen. Dunkelschwarzrot wie das von seinem Blut getränkte splittrige Holz.
Leuchtendrot wie die Kohlen des Lagerfeuers, deren langsamem Verlöschen ich unter dem dunklen Nachthimmel aus dem Schutz seiner Arme heraus so viele Male zusah. Glühendrot wie die Flammen in mir, deren Lodern nie verlischt, die auch die Tränen nicht ersticken können, die schon wieder ihre Spuren in meine brennenden Wangen ätzen. ‚Die Liebe ist Feuerglut, eine mächtige Flamme. Viele Wasser können sie nicht auslöschen, Flüsse können sie nicht hinwegschwemmen.‘
Ich atme tief durch und richte mich auf, recke mein Gesicht dem Morgenrot entgegen. ‚Stark wie der Tod ist die Liebe, ihre Leidenschaft unnachgiebig wie das Grab.‘ Wenn dieses Grab seinen Körper nicht mehr hergibt, um wie viel mehr wird meine Liebe ihn nicht mehr hergeben! Wenn der Tod hier ausharrt, werde ich mindestens ebenso lange hier ausharren! Wir werden sehen, wer siegt, wir werden sehen, ob die Liebe nicht sogar stärker ist als der Tod!
Wenn die Sonne aufgegangen ist, werde ich gehen und mein Tagewerk verrichten, werde ich alles tun, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Aber ich werde wiederkommen, jeden Morgen, wenn die Nacht sich zu Ende neigt, noch im Dunkeln werde ich wiederkommen, werde hier sitzen und warten und suchen. Meine Liebe wird dem Tod ins Auge starren, so lange, bis einer von beiden die Lider senkt. Meine Leidenschaft wird fragen, beharrlich, unaufhörlich, unnachgiebig, jeden den ich sehe, seien es Menschen, Engel, Feinde, Wächter, werde ich fragen, immer wieder nach ihm fragen. Und wenn sie mich dafür schimpfen, und wenn sie mich verfluchen, und wenn mich die Wächter schlagen, wenn sie mir meinen Schleier nehmen, ja wenn sie mich totschlagen, wenn die römischen Soldaten mich totschlagen – ich werde nicht aufhören, sie zu fragen: ‚Habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt?‘
Langsam wird es hell und ich schaue um mich, sehe und höre die Spuren erwachenden Lebens zwischen den Bäumen. ‚Mein Geliebter ist in seinen Garten hinabgegangen.‘ Nicht an diesen Garten hätte ich dabei je gedacht, nicht an eine kalte Kammer hinter schweren Steinen, in denen ein lebloser Körper langsam verwest. Und dennoch schreiben es die hohen Zedern in den Himmel, flüstern es die zarten blauen Anemonen in den Morgen: ‚Ich gehöre meinem Geliebten, und mein Geliebter ist mein.‘
Ich werde zurückkehren in diesen Garten, wo die Zistrosen sich an sein Grab schmiegen, wo die Mandelblüten wie Schnee die Erde bedecken, wo der Lilienduft sich dem Wind hingibt – immer wieder zurückkehren, so lange bis ich sie wieder finde, bis ich sie wieder höre, seine Stimme, die ein Wort sagt, nur ein Wort, ein Wort des Lebens aus seinem Mund. Das eine Wort, das ich damals als allererstes von ihr hörte, als in ihrem Ton ungesagt und doch beredter als alle Worte jede einzelne Zeile, jeder einzelne Vers jenes Liedes, des Königsliedes, des Liedes der Lieder, enthalten war; das eine Wort, das mir lange verloren war, das er mir wieder schenkte, immer wieder neu.
Maryam. Meinen Namen.
© Linde Eller 2010